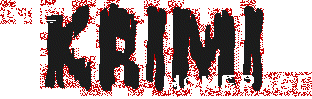| |
Dr. Georg P.
Überlegungen zu den Termini 'Epigone' und 'stilverwandt' in Bezug auf die
deutsche Edgar-Wallace-Serie
Wenn man von Epigonen
spricht, so sollte zunächst die Etymologie des Wortes geklärt werden: das deutsche
Wort ,Epigone‘ ist eine Nominalkomposition, die sich aus dem altgriechischen
Adverb έπί̆
,danach‘ und
dem Nomen γονή ,Geburt‘, ,Nachkommenschaft‘, ,Kinder‘ zusammensetzt. Es
bezeichnet also etwas, das nach der "Geburt" einer Sache oder Person entsteht.
Im Duden-Fremdwörterbuch (61999, p. 231:1) wird der Begriff wie folgt
definiert: „jmd., der in seinen Werken schon vorhandene Vorbilder verwendet od.
im Stil nachahmt, ohne selbst schöpferisch, stilbildend zu sein“.
Sind diese Vorbilder die
Filme der Edgar-Wallace-Serie, so ist zunächst zu klären, welche Stilmittel
diese Reihe unverwechselbar und stilbildend macht. Die Definition eines
typischen Edgar-Wallace-Films ist dabei gar nicht so leicht, da die deutsche
Kinoserie zwischen ihrem Start 1959 und ihrem Ende 1971 teilweise starken
Veränderungen unterworfen war. Da die meisten Konkurrenzproduktionen jedoch
Anfang bis Mitte der 1960er-Jahre entstanden sind, sind für eine Definition die
entsprechenden Produktionen aus dem Hause Rialto Film (bzw. CCC-Film bzw.
Kurt-Ulrich-Film) heranzuziehen (entscheidend ist hier der Produktionszeitraum
und die Vorlage Edgar Wallace und nicht die Produktionsfirma!). Dabei ist
allerdings in Erinnerung zu rufen, dass auch diese Produktionen ab einer
gewissen Phase nur mehr die typischen Stilelemente der ersten Filme kopieren und
daher eher als Rialto-Krimi-typisch gesehen werden müssten zumal diese Filme mit
den Originalromanen des britischen Schriftstellers oft nur mehr sehr wenig zu
tun hatten und etwa der filmübliche Wechsel zwischen Grusel und Komik in den
Werken Edgar Wallace‘ völlig fehlt.
Spricht man andere auf
die Edgar-Wallace-Filme an, so sind die ersten Assoziationen meist
Gruselspannung, abgelegene Schlösser, peitschender Regen, neblige
Londonansichten, etwas Komik und eine skurrile Verkleidung des Täters. Des
Weiteren bringt man häufig verschiedene Regisseure (Alfred Vohrer, Harald Reinl,
Franz-Josef Gottlieb), Musikkomponisten (z. B. Peter Thomas, Martin Böttcher)
und vor allem DarstellerInnen damit in Verbindung (etwa Joachim Fuchsberger,
Heinz Drache, Eddi Arent, Klaus Kinski, Siegfried Schürenberg, Elisabeth
Flickenschildt …).
In vielen Listen werden
nun häufig Filme als Epigonen bezeichnet, die folgende Kriterien erfüllen:
-
Deutsche (Co-)Produktionen
-
Produktionen mit
Wallace-Darstellern
-
Produktionen von
Wallace-Regisseure
-
Whodunit-Dramaturgie
-
Verkleideter Mörder
-
Schwarz-Weiß-Filme
Diese Kategorisierung
führt beispielsweise dazu, dass der Film Das Geheimnis der jungen Witwe
beispielsweise bei Kramp (³2005, p. 478) als Epigone gelistet wird. Es
handelt sich bei dieser deutsch-italienischen Koproduktion um einen
Psychothriller aus der Hand von Regisseur Massimo Dallamano, der später den
vorletzten Rialto-Beitrag Das Geheimnis der grünen Stecknadel/ Cosa avete
fatto a Solange? (1971) inszenierte. Außer dem Regisseur hat der Film aber
überhaupt keinen Bezug zur Wallace-Serie. Entscheidend ist hier, mitzubedenken, ob etwas bewusst als Epigone produziert wurde und durch Titel,
Handlung und womöglich auch Darsteller an die Wallace-Reihe anschließen wollte,
oder ob - und das ist ein bisher völlig unberücksichtigter Faktor - die durch
die Filme in der BRD ausgelöste Krimihysterie von Produzenten ausgenutzt wurde,
um "andere" Krimis zu produzieren und diese dem Publikum in der
Hoffnung zu servieren, dass diese den Krimihorizont auf eine andere
Machart erweitern. Hier können
zusätzlich die Filmtitel, wie etwa Das Geheimnis der jungen Witwe,
durchaus Assoziationen
zur Wallace-Serie hervorrufen und damit die Zuseher neugierig machen. In die
Kategorie "Nicht-stilverwandt", "Nicht-Epigone" fallen etwa m. E. auch die
Jerry-Cotton-Filme und Produktionen wie Ich spreng euch alle in die Luft
(1967) (im Standwerk Kramps (³2005, p. 478) ebenso als Epigone angeführt), die dem
Wallace-Krimi verwöhnten Publikum neue Perspektiven im Kriminalfilm eröffnen
wollten, sich aber weder stilistisch noch dramaturgisch an den Filmen
orientieren.
Schließlich ist es ein weiterer wesentlicher und notwendiger Punkt, die beiden Termini "stilverwandt"
und "Epigone" voneinander zu differenzieren. Während der Begriff 'Epigone' in
der Einleitung bereits definiert wurde und sich ein Film dieser Art bereits
an etwas Existentem orientiert (in diesem Falle den Edgar-Wallace-Filmen) und
meist auch zeitnah zum Original produziert wurde, kann ein stilverwandter Film
auch ohne offensichtlichen Bezug entstanden sein - und das etwa auch vor der
eigentlichen Serie. So könnten manche britisch-amerikanische Spielfilme aus den
1940ern und 1950ern durchaus als stilverwandt zu den Wallace-Filmen betrachtet
werden und auch einige Kriminalfilme, die vor 1959 in Deutschland entstanden
sind, beispielsweise Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958) oder Grabenplatz 17
(1958).
Hier wäre überhaupt auch zu
hinterfragen, in wie weit die deutschen Kriminalfilme der 1950er Jahre die
Edgar-Wallace-Serie beeinflusst haben, ein nicht unbedeutender Faktor, der
bisher leider völlig unberücksichtigt geblieben ist. Als nicht unwesentlich ist
hier auch unbedingt Dietrich Haugks 1960 entstandener Kinofilm Agatha lass
das Morden sein zu betrachten, der zwar von der Handlung und Qualität völlig
indiskutabel ist, aber in punkto gruseliger Atmosphäre und Figurenkonstelation
den Edgar-Wallace-Filmen sehr viel vorweg nimmt und quasi die Quintessenz dieser
Produktionen beinhaltet.
Die Definition einer Epigone hängt nun hauptsächlich davon ab, was man als
Original bezeichnet. Hier beginnt im Bezug auf die Edgar-Wallace-Filme bereits
das Problem, denn ein Großteil der Fans sieht als "original" - völlig
unverständlicher und m. E. auch unkorrekter Weise - nur jene Produktionen an,
die ab 1959 von Rialto Film produziert wurden. Dies geht so weit, dass andere
Filme, die sogar im selben Zeitraum produziert wurden, kurioser Weise als
Epigonen betrachtet werden, was ob der Nennung des Autors im Vorspann von
Non-Rialto-Filmen wie Der Rächer, Der Fluch der gelben Schlange,
Todestrommeln am großen Fluss oder Sanders und das Schiff des Todes
besonders kurios anmutet. Während die ersten beiden Filme sich in ihrer
Dramaturgie und Besetzung kaum von den Rialto-Filmen unterscheiden (und vor
allem Der Rächer nachfolgenden Produktionen in punkto Atmosphäre und
Besetzung eine wesentliche Vorlage liefert), mag die Ausgrenzung der beiden
Afrika-Filme für andere (für mich nicht!) noch irgendwo verständlich sein, wenn
man sich - und das ist wesentlich - unter einem Edgar-Wallace-Film eine
Produktion vorstellt, die
-
im Bezug auf den Ort in England spielt,
-
Handlungsorte wie düstere Schlösser,
unterirdische Gänge, düstere Hafengegenden oder Moorlandschaften aufweist,
-
dazu über peitschenden Regen und neblige
Atmosphäre verfügt,
-
in der Figurenkonstellation eine klare
Trennung zwischen Gut und Böse hat,
-
über eine verbrecherische Organisation
oder/ und eine reiche Erbin in Gefahr erzählt,
-
einen großen Unbekannten aufweist,
-
einen Täter besitzt, der sich entweder
durch eine skurrile Verkleidung oder eine besonderes "Logo" auszeichnet,
-
über humoristische Szenen verfügt, die
die unheimlichen und spannenden Szenen unterbrechen/ aufheitern sollen,
-
darüber hinaus in der Dramaturgie ganz
klare Linien verfolgt (Mord am Anfang, Demaskierung des Täters erst am Ende,
Rettung der Frau in Gefahr etc.)
-
nicht zuletzt über eine ganz bestimmte
Besetzung und Rollenverteilung verfügt und
-
auch im übrigen Cast (im Bezug auf
Drehbuch, Musik, Kamera, Regie etc.) immer die selben Leute versammelt.
Liest man diese - sicherlich erweiterbaren
Kriterien - dann wird klar, dass sich die Edgar-Wallace-Reihe ab einem gewissen
Zeitpunkt (etwa ab 1963/64 bis 1968) nur mehr selbst kopiert und die
verschiedenen Zutaten immer wieder zu neuen "Krimicocktails" zusammen mischt.
Klar ist außerdem, dass damit auch die üblichen offensichtlichen Epigonen wie
Artur Brauners Bryan-Edgar-Wallace-Serie (mit Ausnahme der Filme ab 1969) oder
die Louis-Weinert-Wilton-Filme und einzelne Produktionen wie Das Wirtshaus
von Dartmoor (1964) oder Hotel der toten Gäste (1965) eindeutig als
Epigonen per definitionem zu sehen sind, wobei der Grad der Epigone noch
variierbar ist, denn nicht alle genannten Punkte sind gleich relevant. Dies ist
so beim Ort der Handlung. Ist ein Film, der die obigen Kriterien erfüllt, aber
nicht in England, sondern in Italien oder gar in Thailand spielt, dann etwa
keine Epigone? Wohl kaum.
Völlig unverständlich ist
deshalb, warum Abenteuerkrimis à la Das Todesauge von Ceylon (1963),
Der schwarze Panther von Ratana (1963) oder Der Fluch des schwarzen Rubin
[sic!] (1965) des Münchner Produzenten Wolfgang C. Hartwig in
den meisten Epigonenlisten völlig außer Acht gelassen wurden (so etwa bei Kramp
(³2005), Hohmann (2011); Tses (2002) geht auf gar keine Epigonen ein). Hartwig tauschte
einfach Themsenebel gegen Exotik, Schlösser gegen Tempel und fertig waren Filme,
die großteils in ihrer Machart an die Wallace-Streifen erinnern. Sogar die Komik
kam nicht zu kurz. Während Eddi Arent im Original die Zuschauer bei Laune hielt,
taten das Bill Ramsey oder Chris Howland bei Rapid Film. Der Bösewicht vom
Dienst wurde hier nicht von Klaus Kinski, sondern fast ausschließlich von Horst
Frank verkörpert (der sich zum Leidwesen seiner Fans leider selten selbst
synchronisierte). Damit die Filme (meist deutsch-italienisch(-französisch)e
Koproduktionen) im Ausland ein Erfolg wurden, war der
Ermittler meist ein Geheimagent. So konnten die koproduzierenden Italiener oder
Franzosen den Film als Eurospy vermarkten (und der Agentenname schlug sich hier auch
meist im italienischen Titel nieder). Richtiger Eurospy waren die Filme jedoch
nicht. Im Unterschied zur Kommissar-X-Reihe Theo Maria Werners waren sie
vielmehr Krimis, die als Pseudoagentenabenteuer verkauft wurden. Neben einer Whodunit-Dramaturgie, die in
fast allen dieser Exotikkrimis vorherrscht und den genannten primären Faktoren, sprechen noch weitere
sekundäre Argumente für
eine Einreihung in die Epigonenliste: Regisseure wie Jürgen Roland oder Helmuth
Ashley saßen auf dem Regiestuhl, Martin Böttcher und Willy Mattes waren mitunter
für die Musik verantwortlich, Autoren wie J. Joachim Bartsch oder Hanns Wiedmann
schrieben die Bücher und in den Hauptrollen agierten Schauspieler, die allesamt
in Wallace-Filmen mit dabei waren, unter anderem: Heinz Drache (Der schwarze
Panther von Ratana (1963), Ein Sarg aus Hongkong (1964)), Hans
Nielsen (Das Todesauge von Ceylon (1963)), Marianne Koch und Klausjürgen Wussow
(Heißer Hafen Hongkong (1962)), Joachim Fuchsberger (Das Mädchen von
Hongkong (1972)) oder Harald Leipnitz (5 vor 12 in Caracas (1966)).
Daneben spielten wie bereits erwähnt Horst Frank, Bill Ramsey und Chris Howland
sowie Reinhard Glemnitz, Paul Hubschmid und Marianne Hold (Die Diamantenhölle
am Mekong (1964)), Paul Klinger und Harald Juhnke (Das Geheimnis der drei
Dschunken (1965)), (Die Diamantenhölle am Mekong (1964)), Maria
Perschy und Dietmar Schönherr (Weiße Fracht für Hongkong (1964)) oder
Peter Carsten (Der Fluch des schwarzen Rubin (1965)) mit. Einige Filme
kopieren die Wallace-Reihe sogar so stark, dass sich der direkte Vergleich
aufzwingt: so etwa das Zeichen des Killers in Das Todesauge von Ceylon,
das unweigerlich an das „Logo“ des Mörders in Der rote Kreis erinnert.
Auch Filme
anderer Produzenten wären hier
unbedingt zu berücksichtigen, wie etwa Harry Alan Towers' Produktion Das Haus
der 1000 Freuden (1967), die trotz des absolut trashigen und irreführenden
Titels ein handfester, stilverwandter, ja epigonaler Kriminalfilm ist.
Anhand zweier Filme, die immer wieder als
Epigonen gelistet werden, soll nun geklärt werden, ob dies überhaupt
gerechtfertigt ist. Es handelt sich dabei um Produktionen, die sich auf andere
renommierte britische Kriminalschriftsteller berufen, die es eigentlich nicht
nötig hätten, als Wallace-Epigone verkauft zu werden, zumal sie ganz deutliche,
eigenständige Stilmerkmale aufweisen, die jedoch vor allem in der ersten
besprochenen österreichischen Produktion zugunsten der Wallace-Zutaten völlig
außer Acht gelassen wurden.
Kein anderer britischer
Autor erregte neben Edgar Wallace in den 1950ern und 1960ern soviel Aufsehen wie
Francis Durbridge, dessen mehrteilige Fernsehspiele für enorme
Einschaltquoten sorgten. Mangels eigener Ideen und neuen kreativen Schaffens
wurde der Name des „Original-Straßenfegers“ zweimal für einen Kinofilm
missbraucht. Einmal 1963 für Piccadilly 0 Uhr 12 (Regie: Rudolf
Zehetgruber) und 1964 für den österreichischen Krimi Tim Frazer jagt
den geheimnisvollen Mister X (Regie: Ernst Hofbauer). Während Durbridge im
Vorspann des Zehetgruber-Films noch aufgeführt wird, seine eigenen Ideen aber
weitgehend aus der Handlung eliminiert worden sein dürften (sofern sie überhaupt
vorhanden waren), evoziert im zweiten Film nur mehr die Titelfigur den bekannten
Krimihelden des Autors. Typisch für den „meister der feindosierten Spannung“
waren eben nicht Gangstergeschichten, maskierte Killer, neblige Hafenanlagen und
dubiose Kneipen oder gar die Darstellung von Morden. Wer Durbridge kennt, der
weiß, dass Grusel für ihn ein Fremdwort ist, Morde nur in Abwesenheit des
Zuschauers geschehen und die Darstellung von Gewalt überhaupt nicht zu ihm
passt. In einem Interview hatte der Meister selbst mal gesagt: „Ich bin so
undramatisch, ich kann kein Blut sehen“. Während die Produktion Piccadilly 0
Uhr 12 zwar mit einer unglaublich starken Besetzung punkten kann, erinnert
außer dem Schauplatz London und Klaus Kinski nicht wirklich viel an Francis
Durbridge. Selbst der „geniale“ dramaturgische Gedanke, Ilja Richter als Edgar
Wallace (sprich: [Wεlles] [sic!]) auftreten zu lassen, reicht nicht aus, um den
Film der Serie des britischen Kultautors zuzurechnen. Ganz anders Tim Frazer
jagt den geheimnisvollen Mister X. Hier scheint jede Szene, jede
Einstellung, jeder Dialogteil und die gesamte dramaturgische Ausrichtung einem
Wallace-Film entnommen zu sein, nicht etwas erinnert an Durbridge außer dem
Namen des Protagonisten, der genauso gut John Miller oder Peter Smith lauten
hätte können, ohne etwas an der Handlung zu ändern. Die schmuddeligen
Hafenkneipen, Massenmorde, nebligen Hafenstücke, Schießereien und
Verfolgungsjagden, der eingestreute Humor und der von einem Barmädchen
vorgetragene Song J’ai peché sorgen dafür, dass es sich bei diesem Film
um eine hundertprozentige Epigone handelt, die quasi "echter" als manche
"echten" Wallace-Filme sind (was man im übrigen auch von Beiträgen wie Der
Würger von Schloß Blackmoor (1963) oder mit Vorbehalt auch von Sieben
Tote in den Augen der Katze (1973) behaupten kann). Dass weder der eine noch der andere
Film besonders erfolgreich waren liegt wohl auch daran, dass man mit Durbridge-Erwartungen in den Kinosaal ging und diesen vollkommen enttäuscht
angesichts der Tatsache verlassen musste, dass nichts – aber auch wirklich
nichts – an den großen britischen Meister erinnerte.
Einen anderen Meister der
Kriminalliteratur bemühte man für den Film Sherlock Holmes und das Halsband
des Todes (1962). Arthur Conan Doyles Figur des berühmtesten
Meisterdetektivs der Literaturgeschichte wurde hier dazu missbraucht, um das
Publikum unter Vorspielung falscher Tatsachen ins Kino zu locken. Einerseits
basiert das Drehbuch nur sehr vage auf den Vorlagen, andererseits ist dieser
Krimi kein Whodunit-Film. Dies muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, doch
Spannung entsteht hier weder aus der
Dramaturgie noch aus der Inszenierung heraus. Überhaupt erinnert die Handlung so
gut wie nicht an Edgar Wallace. Daher ist stark zu hinterfragen, warum diese
Produktion (nur aufgrund der Beteiligung einer deutschen Filmfirma und einiger
deutscher Darsteller) immer als Epigone aufgeführt wird. Ebenso verhält es sich
übrigens mit den einigen Dr.-Mabuse-Filmen, die in ihrer
Dramaturgie und mangels Whodunit überhaupt nicht zum Schema der klassischen
Wallace-Filme passen. Wäre dem so, dann müsste man auch den
Science-Fiction-Krimi Ein Toter sucht seinen Mörder (1964, Regie: Freddie
Francis) mit in die Liste aufnehmen, zumal hier sogar Siegfried Lowitz und
Dieter Borsche agieren. Das Problem liegt wohl auch darin, dass es bei diesen
Filmen oft nicht eindeutig Schwarz oder Weiß gibt, sondern dass die Übergänge
oft sehr fließend sind und dass man daher keine starken Grenzen ziehen kann.
Abschließend muss hier noch ein Punkt erwähnt
werden, der - wenn man von Epigonen spricht - unbedingt erwähnt werden sollte
und bisher meines Wissens nirgends hinterfragt wurde. Es handelt sich dabei um
die Umkehrung des üblichen Weges, gewissermaßen von der Epigone zum "Original". Als Artur
Brauner Dario Argentos ersten Spielfilm Das Geheimnis der schwarzen
Handschuhe/ L’uccello dalle piume di cristallo 1969 koproduzierte, war er
seinem „ärgsten“ Konkurrenten Horst Wendlandt erstmals ein Stück voraus. Im
Gegensatz zum von Rialto produzierten Film Das Gesicht im Dunkeln/ A
doppia faccia hatte das Debüt des italienischen maestro del brivido
(Meister des Grusels) einen überragenden Erfolg. Nun mutet es mehr als seltsam
an, dass ausgerechnet Rialto Film 1971
zwei deutsch-italienische Filme ins Wallace-Rennen schickte, die sich in
Handlung und Dramaturgie gänzlich am durch den Argento-Film ausgelösten
Giallo-Boom orientierten und die sich überhaupt nicht mehr auf die so typischen
1960er-Merkmalen beriefen. Hier gab es ein Kuriosum, dass in der Filmgeschichte
wohl einmalig (und wenn nicht, dann sehr selten) sein dürfte: auf Basis einer
als Edgar-Wallace-Epigone verkauften Produktionen vermarktete man nun plötzlich
daran inspirierte Filme als Original (nicht zu vergessen ist, dass man sogar
noch einen dritten Film, Duccio Tessaris Blutspur im Park/ Una farfalla dalle
ali insanguinate (1971), ins Rennen schicken wollte).
Da in der einschlägigen Literatur (Kramp
(³2005), Hohmann (2011)) teilweise ziemlich willkürlich dabei verfahren wird,
was als Epigone anzusehen ist und was nicht, sollten die in diesem Artikel
angestellten Überlegungen dazu anregen, auf Basis von gewissen, zu definierenden
und diskutierenden Faktoren es endlich möglich zu machen, bisher gelistete
Filme, die teilweise nur auf Grund ihres Entstehungsjahres und ihrer Besetzung
gelistet wurden (etwa Mörderspiel (1960) oder Ein Alibi zerbricht
(1963)) aus der Epigonen-Liste endlich zu eliminieren und andere (wohl auch
aufgrund fehlender DVD-Veröffentlichungen) bisher unbekanntere Filme endlich zu
integrieren. Die Wichtigkeit der notwendigen Merkmale für die Zuordnung sollte
dabei gereiht (etwa Handlung vor Handlungsort, Whodunit vor Gangstergeschichte
etc.) und Besetzung und Aufnahmestab sowie Entstehungsjahr in die zweite Reihe
verbannt werden. Schließlich ist noch unbedingt festzuhalten, dass ein
Edgar-Wallace-Film per definitionem immer als solcher zu betrachten ist, sobald
er als solcher beworben wurde oder auch als solcher im Vorspann genannt wird.
Dies bemerke ich vor dem Hintergrund der Tatsache, dass manchmal Filme außerhalb
der Rialto-Reihe schon als Epigonen genannt werden und andererseits Produktionen
aus der Endphase der Serie häufig nur widerwillig als "echte" Wallace-Filme
geduldet werden (so auch von mir). Ein gründliches Überdenken der Zuordnung von
Filmen in die deutsche Edgar-Wallace-Reihe und ihrer Epigonen ist dringend
angebracht.
Bibliographische Hinweise:
Hohmann, Tobias (2011):
Der klassische Kriminalfilm: Edgar & Bryan Edgar Wallace.
Nürnberg: MPW.
Kramp, Joachim (³2005): Hallo! Hier spricht Edgar Wallace.
Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf.
Tses, Christos (2002): Der Hexer, der Zinker und andere Mörder.
Essen: Klartext.
Links:
Das
Edgar-Wallace-Forum
Diskussion: Typischster
Wallace-Film
Diskussion: Typische Wallace-Atmosphäre
Diskussion: Definitionen Epigonen,
Stilverwandt & Co.
Text:
©
Dr. Georg P.
(Die Krimihomepage, 2011/12) |
|